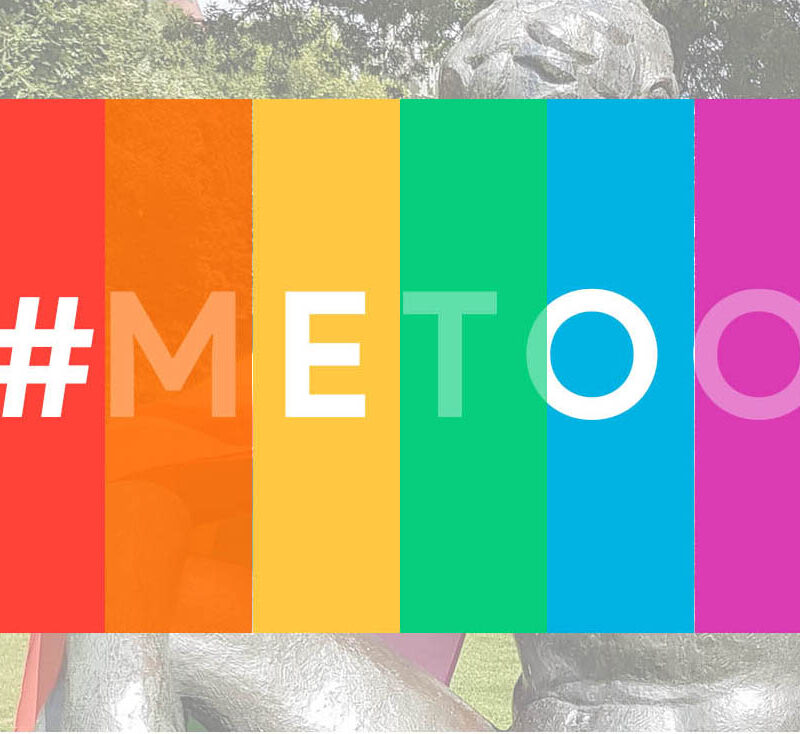„Über die Hälfte aller schwullesbischen und transgender Jugendlichen weisen Essstörungen auf: Dies die erschreckende Erkenntnis einer neuen Studie. Damit liegt das Risiko bei LGBT-Teenagern unter einer Essstörung zu leiden um das 11-fache höher als heterosexuelle Teenager. Auch die Suizidgefahr ist bei diesen Jugendlichen um ein Vielfaches höher…“
Quelle: gay.ch (veröffentlicht am 6. März 2018)
Schön, gibt’s die Studie aus den USA und gut, dass diese Information (wieder) den Weg in die Schweiz findet und zum Denken im europäischen und Schweizer Kontext anregt.
Es ist nicht so, dass mich das Ergebnis freuen würde. Aber schaut euch mal die gesellschaftliche religiös-fundamentalistische Umgebung an, in den LGBTI-Menschen in den Staaten ohne New York und Kalifornien aufwachsen. Wundern kann das also nicht.
Das ist das eine.
Aber das andere muss sein:
Was tun wir jetzt mit diesen Erkenntnissen?
Ein wichtiger Teil der Gründe für Essensstörungen liegt in den psychischen Belastungen in der Kindheit vom Neugeborenen bis in die Pubertät und Jugendalter. Diese Belastungen kommen teils aus den Erwartungen der Eltern, ihrer Ablehnung oder „Unwertschätzung“ ihres Kindes und teils aus dem gesellschaftlichen (hetero-)normativen Druck vom Kindergarten bis Schulende oder darüber hinaus.
Bezogen auf LGBTI-Kinder (das ist kein Schreibfehler, wenn wir davon ausgehen, dass „Kinder so geboren werden“) stellt sich die folgende Frage:
Wann wissen heute die angehenden Eltern, dass sie bei der Geburt ihrer Kinder nicht “nur” mit Rothaarigen, Linkshändigen, Gross-oder Kleinwüchsigen und ev. mit (anderen) „Missbildungen“ (von Klumpfuss über … nein, aus Pietätsgründen führe ich die Aufzählung nicht weiter), sondern auch mit lesbisch, schwul, bisexuell, trans und intersexuell geborenen oder veranlagten Kindern rechnen müssen?
Dies zu vermitteln ist und bleibt die grosse Herausforderung.
Ob das mit dem Unterricht nach Lehrplan 21 dann in 15 – 25 Jahren wirklich bewältigt sein wird, werde ich persönlich wohl nicht mehr erfahren.
In der Zwischenzeit droht nochmals eine Generation von LGBTI-Kindern und jungen Menschen auf dem essensgestörten, suzidgefährdeten, homo-, trans- und interphoben Pflaster auf der Strecke zu bleiben oder wegen mangelnder Anerkennung ihres Seins an sich selbst leiden zu müssen.
„Gehauen oder gestochen“, hier liegt immer noch eine grosse Aufgabe vor den Schwulen- und Lesben-Dachverbänden und den regionalen Vereinen. Die Unterstützung der GLL und der ABQ (und ähnlichen Vereinen in der Romandie) mit ihren Auftritten und Sensibilisierungen in den Schulen sind lobenswert und gehören unterstützt. Wer aber bildet die Ausbildenden aus? Hier besteht ein grosser Nachholbedarf, der – wahrscheinlich auch gegen religiös-fundamentalistischen Widerstand – dringend abzubauen ist!
Und nur nebenbei: Dies wird auch dem Schweizer – und allen weltweiten – Gesundheitssystemen zu Gute kommen.
Max Krieg